Herzlich willkommen auf der Startseite des Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte
Wir sind eine bundesweite ehrenamtliche Initiative, die sich seit 2016 für bessere Arbeitsbedingungen von Honorarkräften und Festangestellten in der Erwachsenenbildung und von DaZ-Lehrkräften
im Schuldienst einsetzt. Unsere Website bietet dafür Informationen, Austausch und Kollegialität.
Sie lebt vom Mitmachen und liefert Dir neueste Informationen zu unserer Lage und unseren Zielen sowie Aktivitäten - wenn Du Dich
- in den Newsletter einträgst oder
- als Kontaktperson unverbindlich meldest.
Bis demnächst also!
Aktuelle Meldungen aus dem Bündnis:
Festanstellungen an der VHS Essen

Die GEW berichtet auf ihrer Webseite über die Festanstellungen an der VHS Essen. "Die VHS Essen geht einen anderen Weg als die meisten Bildungsträger nach dem Herrenberg-Urteil: Anstatt ihre Honorarlehrkräfte bis Ende 2026 in rechtlicher Unsicherheit zu lassen, hat sie konsequent Festanstellungen für bis dahin scheinselbstständig angestellte Mitarbeitende angeboten. Ein aktueller Podcast von wb-web.de zeigt die positiven Auswirkungen für Lehrkräfte und Lernende."
Entscheidend für den Erfolg sei die Hilfe der Politik gewesen. Der Rat der Stadt Essen habe 17 Vollzeitäquivalente für die Volkshochschule bewilligt, um die Kurse langfristig zu sichern. Die TVöD-Anstellungen führten zu deutlich besseren Bedingungen als bei privaten Sprachschulen, die nicht tariflich gebunden seien.
(as)
Bericht über die Aktion in Lüneburg

Am 26.09. fand in Lüneburg eine Aktion statt, die im Rahmen des Aktionstages "Sprache ist der Schlüssel zur In Integration" von der VHS Region Lüneburg organisiert wurde. Es nahmen Mitarbeitende, TeilnehmerInnen und DozentInnen teil.
In der PM der VHS heißt es: "Gemeinsam mit unseren Teilnehmenden der Integrationskurse wollten wir ein deutliches Zeichen setzen: Sprache öffnet Türen – zu Arbeit, Ausbildung, gesellschaftlichem Miteinander und persönlicher Selbstbestimmung.
Unsere Aktion in Lüneburg
· In allen Integrationskursen haben die Teilnehmenden ihre Unterstützung sichtbar gemacht, indem sie Unterschriften für die Aktion gesammelt haben.
· Außerdem haben wir gemeinsam ein Reel gedreht, um zu zeigen, wie einig wir uns in dem Wunsch nach verlässlichen Sprachkursen sind und wie zielgerichtet die Teilnehmenden diese Kurse angehen.
· Dabei wurde deutlich: Jeder Schritt im Spracherwerb ist ein Schritt in Richtung größerer Möglichkeiten – sei es beim Kontakt zu Behörden, im Arbeitsalltag oder einfach im Austausch mit Nachbarinnen und Nachbarn.
Warum der Aktionstag so wichtig ist:
Sprache bedeutet nicht nur Verständigung, sondern auch die Chance, sich eine Zukunft aufzubauen. Gerade Menschen, die neu nach Deutschland kommen, brauchen Räume zum Lernen und Orte, an denen sie sich willkommen fühlen. Volkshochschulen spielen hier eine zentrale Rolle – sie sind Lernorte und Begegnungsräume zugleich.
Aktuell lernen über 350 Teilnehmende jeden Tag Deutsch in 21 Integrations- und Berufssprachkursen der VHS REGION Lüneburg. Unterrichtet werden Sie dabei von 35 engagierten Lehrkräften. Um auch weiterhin diese wichtige Aufgabe ausführen zu können erwarten wir von Bund und Ländern verlässliche Finanzierungszusagen und strukturelle Sicherheit.
Mit diesem Aktionstag wollten wir als VHS REGION Lüneburg gemeinsam mit vielen weiteren Akteur*innen vor Ort und bundesweit ein Zeichen setzen: Investition in Sprachförderung ist Investition in Zusammenhalt und in die Zukunft."
(as)
Bericht über die Aktion in Hamburg

In Hamburg haben am 26.09.2025 etwa 200 KollegInnen zum Teil mit Kursteilnehmenden bei strahlendem Sonnenschein am Aktionstag „Sprache ist der Schlüssel zur Integration“ teilgenommen. Treffpunkt war um 12 Uhr die Behörde für Inneres und Sport Johanniswall 4. Dort wurde das „Forderungspapier Gesamtprogramm Sprache“ übergeben und die ersten Reden von Dirk Mescher, Geschäftsführer der GEW Hamburg, Detlef Zunker, Leiter der Hamburger GEW-Fachgruppe Erwachsenenbildung, und einem Mitglied des SprecherInnenteams Bündnis DaF/DaZ gehalten. Von dort aus ging es durch die Hamburger Innenstadt zum Fahnenplatz am Jungfernstieg, wo Sven Quiring, der Vorsitzende der Hamburger GEW, und KollegInnen aus dem Gesamtprogramm Sprache Reden gehalten haben. Gegen 14 Uhr war die Veranstaltung beendet.
(clm)
Aktion in Hamburg am 26.09.

GEW Hamburg ruft zum Aktionstag am 26. September auf. An diesem Tag setzt die GEW Hamburg gemeinsam mit Lehrenden, Trägern, Betrieben, Verbänden und Teilnehmenden ein starkes Zeichen: Für eine nachhaltige Finanzierung des Gesamtprogramms Sprache, für faire Arbeitsbedingungen und für die Anerkennung der zentralen Rolle von Sprachkursen bei Integration, Teilhabe und beruflicher Perspektive.
Startpunkt des Aktionstags ist um 12 Uhr vor der Behörde für Inneres und Sport (Johanniswall 4). Dort soll das Forderungspapier zum Gesamtprogramm Sprache an Innensenator Andy Grote (angefragt) übergeben werden. Anschließend zieht eine Demonstration durch die Hamburger Innenstadt bis zum Jungfernstieg, wo von 13 bis 14 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.
Aktionstag: Lasst uns die Politik anschreiben!

Das SprecherInnenTeam des Bündnisses DaF/DaZ-Lehrkräfte ruft alle Kolleginnen und Kollegen dazu auf, im Rahmen des Aktionstages am 26. September das Bundesministerium des Inneren (zuständig für I-Kurse), das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (zuständig für BSK) und das BAMF anzuschreiben. Schickt bitte eine E-Mail und hängt das Forderungspapier (Kurz- oder Vollversion) an, das von allen in den BAMF-Kursen tätigen Akteuren verfasst wurde. Das Forderungspapier befindet sich unten. Da ist auch eine Vorlage für den Text der E-Mail, falls Ihr nicht ganz wisst, was zu schreiben wäre. Natürlich kann man den Text auch ändern, ergänzen oder etwas ganz anderes schreiben. In der Vorlage befinden sich die E-Mail-Adressen.
Das Forderungspapier wurde auch von Trägerverbänden (z.B.: DVV, BBB) verfasst und unterschrieben, sodass das übliche Argument gegen jede Aktivität - "Ich habe Angst, keinen Kurs mehr zu bekommen, wenn ich den Mund aufmache." - jeder Grundlage entbehrt. Sollte jemand meinen "Das bringt doch nichts", so sei ihr/ihm gesagt, dass die Aktion sehr viel bringt, wenn Tausende Lehrkräfte mitmachen. Die Kolleginnen und Kollegen müssen endlich aufschreien, denn die Probleme sind enorm. Zu der alten Prekarität ist noch das Herrenberg-Urteil gekommen. Abgesehen davon gibt es noch Probleme mit der Durchsetzung der 29-UE-Regelung. In den nächsten Monaten wird über die Zukunft unserer Branche entschieden. Wenn unsere Interessen berücksichtigt werden sollen, dann müssen wir alle endlich zeigen, dass es uns schlecht geht. Und auch unsere KollegInnen motivieren, ebenfalls aktiv zu werden und beispielsweise eine Mail an die Politik zu schicken.
Wenn Ihr die E-Mail schickt, schreibt bitte unter Eurem Namen, hinter welcher Organisation ihr steht, z.B.: Mitstreiter/in oder Unterstützer/in des Bündnisses DaF/DaZ-Lehrkräfte. Dies stärkt uns, den Aktiven, den Rücken in unseren Gesprächen mit der Politik.
Mehr BSK

Das BAMF informiert in seinem letzten Trägerrundschreiben über die Ausweitung der B2-BSK um voraussichtlich ca. 40 % . Das BMAS hat sich erfolgreich für mehr Mittel für die Berufssprachkurse eingesetzt. Im neuen Regierungsentwurf sind dafür jetzt 450 Mio. Euro statt 310 Mio. vorgesehen. "Dieser Ansatz soll auch für das Jahr 2026 verstetigt werden. Dies erlaubt uns für das anstehende Quartal eine erneute Ausweitung des B2-Kursangebots, nachdem bereits im laufenden dritten Quartal 2025 ein größeres Kontingent an B2-Kursen zur Verfügung gestellt werden und mit dem TRS 07/25 vom 6. Juni 2025 das Zahlungsziel an die Kursträger wieder von 90 auf 30 Tage gesenkt werden konnte."
(as)
SodEG-Rückforderungen
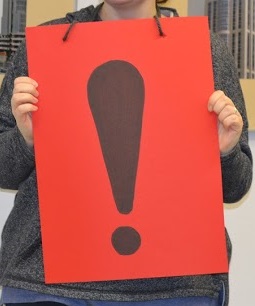
Wir veröffentlichen unten einen Beitrag von einigen Kolleginnen, die sich zusammengeschlossen haben und zu zwei Anwälten gegangen sind. Der Beitrag ist das Ergebnis der beiden juristischen Beratungen.
"SodEG-Rückforderungen durch das BAMF richten sich ausschließlich an den Träger, n i c h t an Honorarkräfte oder Unterauftragnehmer
Während der Corona-Jahre 2020, 2021 und 2022 konnten durch das BAMF zugelassene Träger beim BAMF SodEG-Gelder für den Träger oder für den Träger und die Lehrkräfte beantragen. Ziel war es, einerseits die Existenz der Träger zu sichern und andererseits die Lehrkräfte zu binden, damit diese bei Öffnung der Schule dem Träger zur Verfügung stehen und nicht in andere Berufe abwandern.
Dafür war es notwendig einen Antrag, unterschrieben durch den Träger an das BAMF, zu stellen. Darin hat sich der Träger gegenüber dem BAMF verpflichtet, mindestens 75 Prozent an Ausfallhonoraren an die Lehrkräfte zu zahlen, wenn die Schule geschlossen ist. (75 Prozent bezogen auf das Honorar 2019 der konkreten Lehrkraft).
Bis Ende 2024 hat das BAMF in einer Abschlussrechung die SodEG-Zahlungen 2020 auf Richtigkeit überprüft. Dazu musste der Träger konkrete Zahlen aus 2020, bestätigt durch einen Steuerberater, an das BAMF schicken. Es gibt Träger, wo Antrag und Abschlussrechnung übereinstimmen und es gibt Träger, wo das BAMF Rückforderungen gegenüber dem Träger in Rechnung stellt. Diese SodEG-Rückforderungen durch das BAMF richten sich ausschließlich an den Träger, n i c h t an Honorarkräfte oder Unterauftragnehmer. Mögliche Rückforderungsgründe des BAMF an den Träger können z.B. vorrangige Mittel, keine oder fehlerhafte Nachweise oder Falschangaben bei Antragstellung sein.
Wir weisen darauf hin, dass Honorare vor Arbeitsantritt vereinbart werden und im Nachgang nicht korrigiert werden können. Die Mindesthonorare und auch die Mindestvergütung bei SodEG-Ausfallhonoraren sind vom BAMF vorgegeben und können nicht vom Träger unterschritten werden. Es gibt k e i n e rechtliche Grundlage dafür, dass SodEG-Rückforderungen des BAMF an den Träger durch den Träger weitergereicht werden an die Lehrkräfte."
(efg)
Aktionstag, 26. September 2025, "Sprache ist der Schlüssel zur Integration"

Gemeinsam mit Trägerverbänden, Gewerkschaften und und anderen Akteuren im Bereich der BAMF-Kurse rufen wir, das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, zu einem Aktionstag am 26. September auf. Wir wollen auf die Probleme in unserer Branche hinweisen, Forderungen stellen und Lösungen vorschlagen.
Für den Aktionstag wurde ein Leitfaden (unten) mit vielen Ideen vorbereitet. Es gibt auch ein Forderungspapier "Gesamtprogramm Sprache" (unten), das im Rahmen der Aktionen verwendet werden kann.
Unser Bündnis ruft seine Lokalgruppen und alle Kolleg*innen dazu auf, sich an dem Aktionstag aktiv zu beteiligen. Unsere Probleme sind riesig! Wer weiterhin abwartet und sich drückt und duckt, wird wahrscheinlich bald unseren schönen Beruf aufgeben müssen und wohl auch wollen!
(as)
ver.di-Umfrage: Gute Arbeit in der Weiterbildung?
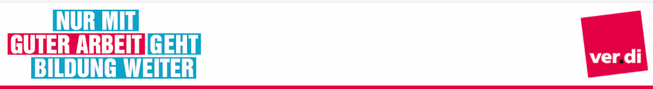
Die gesellschaftliche Transformation ist in vollem Gange – doch wer gestaltet sie mit? Beschäftigte in der Weiterbildung sind zentrale Akteur*innen dieser Entwicklung. Ihre Perspektiven sind gefragt.
Am 17. Juni ist die große ver.di-Befragung zur Guten Arbeit in der Weiterbildung gestartet – für alle, die in der Branche tätig sind: ob selbstständig, abhängig beschäftigt oder im Ehrenamt.
Die Befragung basiert auf dem bewährten DGB-Index Gute Arbeit, einem wissenschaftlich fundierten Instrument zur Erfassung von Arbeitsbedingungen. Damit wird eine differenzierte, faktenbasierte Bewertung der Arbeitsbedingungen möglich – aus Sicht derer, die täglich Bildungsarbeit leisten.
Jetzt ist der Moment, um sichtbar zu machen, was oft übersehen wird: die Realität der Arbeitsbedingungen, die Qualität der Bildungsarbeit – und die politische Bedeutung der vierten Säule des Bildungssystems.
Ihre Unterstützung zählt doppelt! Bitte nehmen Sie an der Befragung teil – und helfen Sie mit, sie weiter zu verbreiten. Wir möchten möglichst viele Perspektiven aus der Bildungsarbeit einfangen. Hier geht es zur Befragung!
(ver.di)
Petition gegen Kürzungen bei den BSK

Vor zwei Tagen wurde eine Petition gestartet: Deutschlehrer*innen: Demontage der Berufssprachkurse endlich stoppen! Das Bündnis unterstützt diese Petition und bittet alle Kolleg*innen darum, sie zu unterschreiben.
(as)
Weiteres Urteil zum Urlaubsrecht für Honorarlehrkräfte

Die GEW berichtet in ihrem Beitrag "Urlaubsrecht für Honorarlehrkräfte bestätigt" darüber, dass das Landesarbeitsgericht Köln Honorarlehrkraft in Integrationskursen als „arbeitnehmerähnliche Person" anerkennt. Damit hat sie Recht auf bezahlten Urlaub.
"Das Kölner Gericht stellte fest, dass Honorarlehrkräfte wirtschaftlich abhängig sind und eine ähnliche soziale Schutzbedürftigkeit haben wie Arbeitnehmer*innen. Deshalb stehe ihnen ein Urlaubsanspruch zu. Besonders hervorzuheben ist: Das LAG Köln wies zusätzlich auf die Notwendigkeit der Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsstunden hin."
In dem Beitrag wird auch auf ein anderes Urteil aus BaWü hingewiesen. Das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte informiert seit Jahren über den Anspruch auf Urlaubsentgelt. Vor Kurzem haben die KollegInnen von der VHS Lübeck das Urlaubsentgelt erkämpft.
(as)
DFL Kultur über die Lage der Lehrkräfte im Integrationsbereich

Deutschlandfunk Kultur hat ein ausführliches Interview mit einer Kollegin, die auch in unserem Bündnis aktiv ist, veröffentlicht: Prekär beschäftigt – Die Lage der Lehrkräfte im Integrationsbereich
(as)
Mehr Geld für Integrationskurse

Die Tagesschau informiert in einem Beitrag darüber, dass die Bundesregierung die Finanzierung der Integrationskurse erhöhen will. "Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei hervor. Demnach sollen zu den ursprünglich vorgesehenen Ausgaben von rund 763 Millionen Euro für das laufende Jahr nochmals über 300 Millionen Euro dazukommen. Das Bundesfinanzministerium habe der überplanmäßigen Ausgabe von rund 302,8 Millionen Euro bereits zugestimmt. Damit will der Bund 2025 mehr als eine Milliarde Euro in Integrationskurse investieren."
(as)
GEW-Fachgruppe Weiterbildung rockt die 1. Mai-Demo

Mit viel Energie, Kreativität und lautstarken Forderungen hat die GEW-Fachgruppe Weiterbildung die DGB-Demo am 1. Mai 2025 gerockt. Rund 50 engagierte Kolleg*innen zogen mit Transparenten und Plakaten durch die Straßen, um für bessere Arbeitsbedingungen und einen „Branchentarifvertrag jetzt!“ zu demonstrieren. Besonders im Fokus: die verbindliche Obergrenze von 29 Unterrichtseinheiten pro Vollzeitstelle im Gesamtprogramm Sprache.
Ein Höhepunkt der Demonstration war die Zwischenkundgebung, bei der Detlef Zunker, Sprecher der GEW-Fachgruppe Erwachsenenbildung, eindrucksvoll die prekäre Situation der Erwachsenenbildung schilderte. Vom Lautsprecherwagen aus forderte er klare Maßnahmen: Einen Branchentarifvertrag für den gesamten öffentlich verantworteten Bereich einschließlich des Gesamtprogramms Sprache und endlich aktives Handeln des Hamburger Senats und der Bundesregierung! Zur Rede von Detlef Zunker
(gew-h)
DLF: Kürzungen bei den BSK

Der Deutschlandfunk Kultur berichtet in seinem ausführlichen Beitrag Hürden für ausländische Fachkräfte – Kürzung bei Berufssprachkursen darüber, wie sich die Kürzungen der Mittel für BAMF-geförderte Kurse auf den Bereich der BSK auswirken. Es geht um Folgen für die TN, Lehrkräfte, Träger und das ganze Land.
Was tun, wenn der Träger die 29-UE-Regelung nicht einhält?

Vor einigen Wochen hat das BAMF die wöchentliche Arbeitszeit auf 29 UE, die 40 Stunden entsprechen, begrenzt. Unser Bündnis begrüßt die Entscheidung. Wir waren es, die seit Jahren eine Faktorisierung des Unterrichts gefordert haben und auch dieses Projekt in Angriff genommen haben.
In den letzten Wochen haben wir allerdings erfahren, dass viele Träger gegen diese neue Regelung großen Widerstand leisten. Es wird angekündigt, dass die Verträge für Festangestellte nicht auf 29 UE Vollzeit geändert werden, sondern alles bleibt wie bisher! Verträge weisen die Zahl der UE gar nicht aus, sondern es werden nur Zeitstunden angegeben und festgelegt, dass die Lehrkraft neben der Unterrichtstätigkeit noch so und so viele Stunden Büroarbeiten übernehmen muss. Oder der Träger kündigt an, künftig gar keine Lehrkräfte mehr festanzustellen, da ihm die neue Regelung des BAMF nicht gefällt.
Was können die Lehrkräfte tun, um die neue 29-UE- Regelung durchzusetzen?
A. Zuerst sollten sich die Lehrkräfte eines Trägers zusammentun und gemeinsam neue Verträge verhandeln. Allein hat man kaum eine Chance. Am besten wäre es, einer Gewerkschaft wie der GEW
beizutreten und ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch ver.di ist denkbar, je nachdem welche Gewerkschaft vor Ort aktiver ist. (Z.B. in Berlin hat ver.di sehr viel erreicht.) Unsere
Erfahrung zeigt deutlich, dass in den letzten Jahrzehnten überall dort, wo die Lehrkräfte sich organisiert haben, erhebliche Verbesserungen erkämpft werden konnten. Waren
die Gewerkschaften mit an Bord, geschah es sogar relativ schnell und einfach. Die letzten Beispiele sind VHS
Hamburg (Beteiligung der VHS an den Sozialabgaben) und VHS Lübeck (Urlaubsentgelt).
B. Auf keinen Fall dürfen wir das Narrativ der die neue Regelung ablehnenden Träger übernehmen. Einige KollegInnen tun es schon und kritisieren die neue Regelung, womit sie den anderen in den Rücken fallen.
1. Viele Träger meinen, die 29-UE-Regelung sei unrealistisch und bedeute weniger Geld, weil man ja auch weniger arbeite. Das ist falsch: Wie im Trägerrundschrieben steht, entsprechen die 29 UE einer Vollzeitstelle mit 40 Stunden pro Woche. Die meisten von uns haben einfach in den letzten Jahren viel zu viel gearbeitet. Wer seinen Job gewissenhaft gemacht hat, hat bei 40 UE pro Woche mit Vor- und Nachbereitung sowie anderen Zusammenhangtätigkeiten 50-60 Stunden gearbeitet. Alle Zusammenhangtätigkeiten befinden sich in unserer Umfrage. Und die offizielle Liste des BAMF ist unter diesem Beitrag als PDF zu finden.
Wir sollten also damit argumentieren, dass wir dank der neuen Regelung endlich 40 Stunden und nicht 50-60 arbeiten. Jahrelang, manchmal sogar jahrzehntelang haben die Träger von unserer Mehrarbeit profitiert. Jetzt sollen sie endlich jede Stunde, die wir gearbeitet haben, bezahlen. Natürlich gab es auch einige KollegInnen, die bei ihren 40 UE pro Woche nur das Minimum gemacht haben, was auch verständlich ist, denn warum sollten sie was tun, was nicht bezahlt wurde. Einige Träger haben sogar empfohlen, den TN mehr Stillarbeit zu geben und im Unterricht zu korrigieren. "Dann müsst Ihr ja auch nicht zu Hause arbeiten!" Oder die KollegInnen haben kaum Textproduktionen aufgegeben, um sie nicht korrigieren zu müssen. Was beides für die Unterrichtsqualität bedeutet, liegt auf der Hand. Jetzt aber gibt es keine Ausreden mehr! Bei 29 UE gibt es genug Zeit für die Vor- und Nachbereitung sowie die anderen Zusammenhangtätigkeiten. Der Träger darf eventuell eine Dokumentation verlangen.
Eine Stelle mit 29 UE pro Woche ist also eine Vollzeitstelle mit 40 Stunden pro Woche und muss auch entsprechend bezahlt werden, im Prinzip also genauso wie die alte Stelle mit 40 UE (oder mehr).
2. Zu dem Narrativ vieler Träger gehört auch das Argument der Unfinanzierbarkeit. "Die 29 UE lassen sich nicht finanzieren." Es stimmt zwar, dass die Trägerpauschale generell zu niedrig ist, weswegen unser Bündnis zusammen mit den Trägerverbänden um eine erhebliche Erhöhung derselben kämpft, aber sogar die aktuelle Trägerpauschale ermöglicht die Finanzierung der neuen Regelung. Dazu gibt es einen guten Beitrag von der GEW Bayern.
Natürlich wird die neue Regelung den Gewinn der Träger erheblich senken. Für einige Träger, vor allem für die sog. Bildungskonzerne, wird es sehr eng. Aber so ist das in der Wirtschaft. Manchmal geht man Pleite oder muss man sich beruflich verändern. Tausende Lehrkräfte mussten es in den letzten Jahren tun, beispielsweise während der Pandemie, auch weil einige unfaire Träger sich geweigert haben, das SodEg zu beantragen.
In den letzten Jahren haben viele Träger die Honorarstellen abgeschafft und ihre Lehrkräfte praktisch gezwungen, feste Stellen mit 40 und mehr UE pro Woche anzunehmen. Auf diese Weise haben sie viel mehr verdient, denn eine Honorarkraft ist wegen vorgeschriebenen Mindesthonorars viel teurer als eine Angestellte, die 40 UE pro Woche für 3200-3400 € brutto im Monat schuftet. Jeder, der rechnen kann, sieht es sofort. Jetzt ist aber Schluss mit diesen sittenwidrigen Verträgen, was nicht nur die Lehrkräfte begrüßen, sondern auch nicht wenige faire Träger, die ihre festangestellten Lehrkräfte "nur" 34, 32 oder 30 UE arbeiten ließen oder eben die "teuren" Honorarkräfte engagierten und gleichzeitig mit den unfairen Trägern konkurrieren mussten.
An dieser Stelle soll endlich eine Lanze für faire Träger gebrochen werden. Die gibt es nämlich, und nicht so wenige, wie manche denken. Diese Träger kümmern sich sehr gut nicht nur um die TN und die Unterrichtsqualität, sondern auch um die Lehrkräfte. Sie helfen sogar bei persönlichen Problemen. Auch gibt es viele sehr gute FachbereichsleiterInnen, die versuchen, unsere Arbeitsbedingungen so gut wie möglich zu verbessern. Unser Bündnis hat nie die Träger als Gegner oder Feind betrachtet. Ganz im Gegenteil, wir haben immer Kontakt zu den Verbänden gesucht und Zusammenarbeit angeboten, denn nach unserer Meinung sitzen wir alle in einem Boot, dessen größtes Problem die Unterfinanzierung durch die Politik ist. Auch heute arbeiten wir gut mit einigen Trägerverbänden zusammen und wissen, dass es dort sehr kluge Aktive gibt, die auch an unsere Interessen denken.
Deshalb rät das Bündnis bei Problemen mit dem Träger immer dazu, zuerst höflich um ein Gespräch zu bitten und zu versuchen, sich mit dem Träger zu einigen. Es ist nicht gut, gleich mit einer Klage zu drohen. Nicht selten sind die Leitungen bzw. FachbereichsleiterInnen nicht gut informiert und behaupten etwas, was nicht stimmt.
3. Einige Träger haben bereits verkündet, dass der Mindestlohn in der Weiterbildung nicht für die BAMF-Kurse gelte. Andererseits haben sie sich aber in den letzten 20 Jahren immer auf diesen Mindestlohn berufen, um nachzuweisen, dass sie sich an das Gesetz halten. Wenn wir auf die äußerst prekären Gehälter hinwiesen und mehr Geld wollten, hörten wir immer: " Was wollt ihr denn. Wir zahlen doch den Mindestlohn!" Jetzt, wo es ihnen nicht mehr nützt, wollen sie von dem Mindestlohn nichts mehr wissen. Damit sägen sie an dem Ast, auf dem sie sitzen.
4. Ein anderes Argument vieler Träger gegen die 29-UE-Regelung ist ihre angebliche Unverbindlichkeit: „Das ist doch nur eine Empfehlung.“ oder „Im TRS steht doch nur ‘soll’.“ Unser Bündnis hat deswegen bereits das BAMF und das BMAS angeschrieben. In dem Antwortschreiben steht u.a. geschrieben, dass die Regelung verpflichtend sei. Fall es zu Verstößen komme, könne im Extremfall die Zulassung widerrufen werden.
Wenn uns unser Träger also einen Vertrag anbietet, der gegen die neue 29-Regelung verstößt, sollten wir das BAMF informieren und ihm den Vertrag zuschicken. Dabei wäre es sehr gut, unser Bündnis ins CC zu setzen. Wer bei der GEW oder bei ver.di ist, was wir an dieser Stelle noch einmal empfehlen, wende sich zuerst natürlich an die Rechtsstelle. Man kann auch an das Sprecherteam unseres Bündnisses schreiben, und wir sorgen dafür, dass die Meldung schnell bei den zuständigen BAMF-MitarbeiterInnen ankommt. Für neue Verträge gilt die Regelung schon jetzt, für die alten ab dem 1. Januar.
5. In den neuen Verträgen müssen wir darauf bestehen, dass die Anzahl der UE deutlich angegeben wird. Beträgt sie 29, dürfen wir keine anderen Aufgaben akzeptieren. Natürlich kann man regeln, was passiert, wenn es einige Tage oder Wochen ohne Kurse oder mit weniger UE gibt. Dann müssen wir auch flexibel sein, denn die 29 UE sind ein Richtwert, und dürfen wohl unter bestimmten im Vertrag beschriebenen Umständen über- und unterschritten werden.
6. Es gibt noch etwas, was uns helfen könnte, wenn unser Träger zu viele UE verlangt. Es handelt sich um das Arbeitszeiterfassungsgesetz . Das ist aber schon etwas für Rechtsstellen der Gewerkschaften bzw. Anwälte. Dasselbe gilt auch für die Überlastungsanzeige.
(as)
"Braucht Erwachsenenbildung Honorarlehrkräfte?"

Wir veröffentlichen einen Beitrag der Landesfachgruppe EB (Erwachsenenbildung) der GEW Berlin. Auch wenn das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte nicht jede in dieser Veranstaltung geäußerte Meinung teilt und einiges auch anders sieht, halten wir es generell für sehr hilfreich und zielführend, sich zu treffen, zu diskutieren und sich endlich zu organisieren. Denn "Nur gemeinsam können wir etwas erreichen." So heißt unser Motto. Und zurzeit wird über Themen diskutiert und entschieden, die unsere Branche verändern werden. Wenn wir mit bestimmen wollen, müssen wir uns endlich engagieren.
"Bei der Veranstaltung am 17.1.24 im Haus der GEW Berlin war das Thema „Braucht Erwachsenenbildung Honorarlehrkräfte?“. Teils in Präsenz und teils digital waren 18 Kolleg:innen dabei, die überwiegend DaF-DaZ unterrichten entweder an den Berliner VHS oder bei privaten Trägern.
Mehrere Kolleg:innen beschäftigten sich mit der Frage, ob sie lieber selbstständig oder angestellt arbeiten würden, wenn sie die Entscheidungsfreiheit hätten. Diese Frage ist an sich nicht neu, hat aber nach den Herrenberg- und Göttingen-Urteilen des Bundessozialgerichts eine größere Brisanz erlangt, weil diese Urteile bei der Feststellung eines Angestellten-Status dem Merkmal der Einbindung im Betriebsablauf einen höheren Wert einräumen als davor." Mehr unten
(as)
29 UE: Maximale wöchentliche Unterrichtseinheiten von festangestellten Lehrkräften

In seinem Trägerrundschreiben Berufssprachkurse 03/25 informiert das BAMF über die Festlegung von maximalen wöchentlichen Unterrichtseinheiten von festangestellten Lehrkräften.
"In der Arbeitsgruppe "Maximum wöchentlicher Unterrichtseinheiten für festangestellte Lehrkräfte in Integrations- und Berufssprachkursen" haben zahlreiche Expertinnen und Experten aus den Bereichen Lehrkräfte, Berufsverbände, Kursträger, Gewerkschaften, Wissenschaft und öffentliche Verwaltung darüber beraten, in welchem Verhältnis die Zahl der Unterrichtsstunden in Integrations- und Berufssprachkursen zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit stehen sollte.
Ziel war es, die sogenannten „Zusammenhangstätigkeiten“ angestellter Lehrkräfte außerhalb der Unterrichtstätigkeit konkret zu beschreiben und auf dieser Basis eine Schätzung zu deren Zeitbedarf zu erstellen.
Im Ergebnis wurde ermittelt, dass bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche nicht mehr als 29 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten geleistet werden sollten, um eine sorgfältige Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sicherzustellen. Es handelt sich dabei um einen rechnerischen Durchschnittswert für alle Kursarten, der als Richtwert verstanden werden kann. Bei einer Teilzeittätigkeit muss selbstverständlich eine der Wochenarbeitszeit entsprechende Umrechnung erfolgen. (...)
Die geänderten Nebenbestimmungen sind bei Abschluss entsprechender Arbeitsverträge zwischen Trägern und fest angestellten Lehrkräften sofort zu beachten. Ab dem 01.01.2026 finden sie uneingeschränkte Anwendung.
Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass freiberuflich tätige Lehrkräfte die Umstände ihrer Tätigkeit frei aushandeln können und auch nicht an gesetzliche Regelungen zum Arbeitnehmerschutz wie die wöchentliche Höchstarbeitszeit gebunden sind. In der Konsequenz können die o.g. Maßstäbe daher bei freiberuflich Tätigen zwar als Orientierung dienen, Geltung entfalten sie indes ausschließlich für fest angestellte Lehrkräfte. Ein inhaltsgleiches Trägerrundschreiben ergeht an die Träger der Integrationssprachkurse."
In der Anlage steht geschrieben: "Bei festangestellten Lehrkräften soll bei einer Vollzeitstelle von 40 Wochenstunden eine regelmäßige Unterrichtszeit von 29 Unterrichtseinheiten nicht überschritten werden, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht gewährleisten zu können."
Es war das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, das im Jahre 2021 eine Faktorisierung des Unterrichts in den BAMF-Kursen gefordert hat. Wir haben dieses Projekt in Angriff genommen. Dann haben wir an einer Anhörung vor dem Expertengremium teilgenommen und haben immer wieder nachgehakt. Unser Ziel waren zwar 25 UE pro Woche, wie auch in der Studie der GEW Hamburg gefordert, aber 29 sind auf jeden Fall viel besser als die üblichen und sittenwidrigen 40 UE pro Woche. Insofern können wir von einem Erfolg sprechen.
Jetzt müssen die festangestellten Lehrkräfte aufpassen, wenn sie die neuen Verträge unterschreiben. Diese 29 UE sind nur die Unterrichtszeit. Dazu kommen noch die zahlreichen Zusammenhangtätigkeiten, wie z.B. Vor- und Nachbereitung, Fortbildung, Probeprüfungen, Übergabe usw., sodass wir am Ende Vollzeit, also 40 Zeitstunden arbeiten. Das neue Gehalt müsste also wie bisher bleiben und darf eigentlich den Mindestlohn in der Weiterbildung nicht unterschreiten. Auf diesen Mindestlohn haben sich ja viel Träger bis jetzt gern berufen. Es ist davon auszugehen, dass es vom BAMF noch genauere Bestimmungen geben wird.
Aber es liegt bereits jetzt eine sehr gute Argumentationshilfe für eventuelle Verhandlungen vor. Erwin Denzler, Wirtschafts- und Arbeitsjurist und Gewerkschaftssekretär bei der GEW Bayern, hat in seinem Beitrag "Angst vor dem Arbeitsvertrag" berechnet, dass eine feste Stelle mit 28 UE (pro Woche) als Vollzeit mit einem Bruttogehalt von ca. 3.385 Euro (Mindestlohn Weiterbildung) auch mit den jetzigen Kostensätzen des BAMF problemlos zu finanzieren sei.
(as)
FORDERUNGSPAPIER Gesamtprogramm Sprache

Gestern wurde ein Forderungs- und Positionspapier zum Gesamtprogramm Sprache veröffentlicht, an dem in den letzten Wochen alle in diesem Bereich tätigen Akteure (Trägerverbände, Gewerkschaften usw.), auch unser Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, gemeinsam gearbeitet haben. Entstanden ist ein sehr gutes und detailliertes Papier, in dem auch die Interessen der Lehrkräfte deutlich genannt werden. Das Papier ist Pflichtlektüre für alle engagierten Kolleginnen und Kollegen. Die Hauptforderungen lauten:
- eine auskömmliche Finanzierung des Gesamtprogramms Sprache!
- eine Erhöhung des Kostenerstattungssatzes, grundlegende Verwaltungsvereinfachungen und eine verlässliche Einhaltung des Zahlungsziels für durchgeführte Kurse von 30 Tagen!
- Planungssicherheit für Sprachkursträger und Lehrkräfte!
- wettbewerbsfähige Einkommen und Arbeitsbedingungen, die dem Qualifikationsniveau der Lehrkräfte entsprechen!
- zusätzliche Mittel zur digitalen Qualifizierung von Lehrkräften sowie Ausstattung der Träger!
- einen Anspruch auf adäquate Sprachförderung für alle Zugewanderten!
- mehr Gestaltungsspielraum für Träger und Lehrkräfte, um den Lernweg der Teilnehmenden flexibler und individueller zu gestalten - auch mit digitalen Lernsettings!
(as)
Herrenberg-Urteil: Übergangsregelung bis Ende 2026

Die GEW berichtet in einem ausführlichen Beitrag über die Übergangsregelung für Honorarlehrkräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen. Es geht um das "Herrenberg-Urteil" zur (Schein)Selbstständigkeit und betrifft die meisten Kolleginnen und Kollegen im DaZ-Bereich. Lesenswert ist auch der Beitrag des Paritätischen Gesamtverbands.